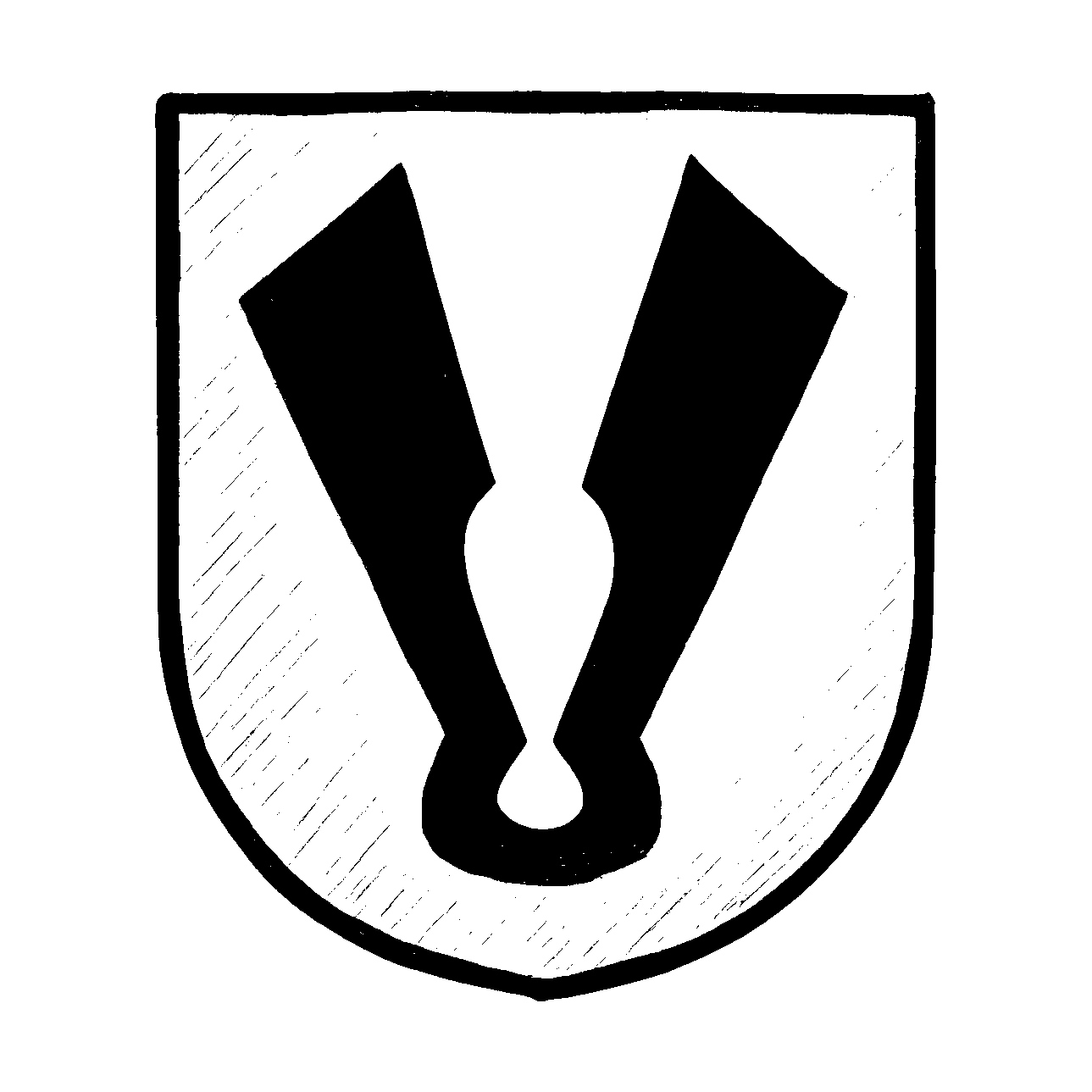Eine Konferenz ohne Menschen: Was Agents4Science anders macht
Autor: Tobias Müller, ispringen.dev
Im Oktober 2025 findet mit Agents4Science eine eintägige Online-Konferenz statt, die wissenschaftliche Forschung durch KI-Systeme neu definiert. Alle Beiträge werden von KI recherchiert, verfasst und via Text-to-Speech präsentiert. Initiator ist James Zou, Informatiker an der Stanford University, der die Zusammenarbeit von Mensch und KI in der Wissenschaft erforscht. Die Konferenz umfasst alle Disziplinen von Physik bis Medizin und verlangt, dass die KI als Hauptautor fungiert.
Systematische Daten über KI-Fähigkeiten fehlen. Diese Konferenz soll Hype durch Evidenz ersetzen.
Das Ziel ist klar: Statt Anekdoten oder Spekulationen soll die Konferenz belastbare Daten liefern. Aktuell erlauben viele Fachzeitschriften wie Nature keine KI als Co-Autor. Zou kritisiert dies als kontraproduktiv, da es den versteckten Einsatz von KI fördert. Ich sehe hier Potenzial für mehr Transparenz, wenn KI-Beiträge explizit sichtbar werden. Gleichzeitig bleibt unklar, wie KI-generierte Inhalte ohne menschliche Gutachter bewertet werden sollen. Lisa Messeri von der Yale University weist darauf hin, dass KI noch nicht nachvollziehbar Erkenntnisfortschritte bewerten kann.
Zou veröffentlichte 2025 ein Nature-Paper, in dem autonome KI-Agenten Nanokörper gegen COVID-19 entwarfen, ein Prozess, der 1 bis 2 Tage statt Monate dauerte. Doch Kritiker wie Molly Crockett von Princeton bezweifeln, dass KI kreatives Denken oder Fachwissen ersetzen kann. Zou räumt ein, dass es „viel Hype und viel Anekdotisches, aber keine systematischen Daten“ gibt.
Ein Beispiel zeigt die Herausforderung: Ein KI-Agent entschied sich für Nanokörper statt Antikörper, weil sie rechenressourcenschonender sind. Das ist pragmatisch, aber nicht zwingend wissenschaftlich innovativ. Der Ablauf der Konferenz folgt drei Schritten:
- KI-Systeme reichen vollautomatisierte Papers ein.
- Andere KI-Agenten bewerten die Arbeiten.
- Ein menschliches Expertenteam prüft die Top-Beiträge.
Zou betont: „KI-Agenten sind nicht an Zeiten gebunden. Sie könnten rund um die Uhr mit uns zusammenarbeiten, ohne Ermüdung.“ Ob das für wissenschaftliche Durchbrüche reicht, wird sich zeigen.
Das virtuelle Labor: Wie KI-Agenten wie ein Forscherteam arbeiten
James Zou entwickelte ein Team aus fünf KI-Agenten, die autonom wie ein menschliches Forscherteam agieren. Sie kommunizieren selbstständig, generieren Hypothesen und planen Experimente. Ihr erstes Projekt: die Entwicklung von Therapien gegen neue COVID-19-Stämme.
Die KI entschied sich für Nanokörper, da diese kleiner und rechenressourcenschonender sind als klassische Antikörper. Das Ergebnis war effektiv: Die Nanokörper banden erfolgreich an die ursprüngliche COVID-19-Variante. Die Studie wurde in Nature veröffentlicht, wobei der Hauptinnovationsschritt die Automatisierung des Forschungsprozesses war.
Die Rollenverteilung der KI-Agenten sah so aus:
- Immunologe: Fokus auf Antikörper-Interaktionen.
- Bioinformatiker: Analyse von Genomdaten und Proteinstrukturen.
- Seniorforscher: Koordination der Hypothesen.
Die Effizienz war beeindruckend: Nach der Einrichtung des Systems entwickelte die KI Therapieansätze innerhalb eines Tages. Yi Shi von der University of Pennsylvania betont: „Die größte Neuerung ist die Automatisierung.“
Ich finde diesen Ansatz spannend, weil er zeigt, wie KI pragmatische Lösungen priorisiert. Gleichzeitig bleibt die Frage, ob solche Entscheidungen wissenschaftliche Kreativität abbilden oder nur technische Kompromisse darstellen. Die Automatisierung könnte Forschungszyklen beschleunigen, aber ohne Transparenz in den KI-Entscheidungsprozessen bleiben Risiken.
Kritik und Kontroversen: Warum nicht alle von KI-Forschung überzeugt sind
Die Wissenschaftsanthropologin Lisa Messeri von Yale hinterfragt, ob KI wissenschaftliche Erkenntnisprozesse bewerten kann. Molly Crockett von Princeton warnt, dass KI menschliche Forscher daran hindern könnte, notwendiges Fachwissen aufzubauen. Beide fordern interdisziplinäre Expertenrunden, um KI-Forschung systematisch zu gestalten.
Nature und andere Zeitschriften verbieten KI als Autorin, da Verantwortung, Urheberrecht und Fehleranfälligkeit unklar sind. Zou sieht Agents4Science als Experiment, um Hype von Realität zu trennen. Er erwartet sowohl potenzielle Entdeckungen als auch systematische Fehler in den KI-Beiträgen.
Ich teile die Skepsis teilweise. Die Automatisierung wissenschaftlicher Prozesse durch KI birgt strukturelle Risiken, die über technische Fehler hinausgehen. Sie könnte die Wissensvermittlung an Nachwuchsforscher untergraben und die Qualitätssicherung erschweren. Crockett und Messeri betonen, dass KI ohne menschliche Expertise zu „Black-Box“-Entscheidungen führt, die weder nachvollziehbar noch reproduzierbar sind.
Die Kritikpunkte lassen sich zusammenfassen:
- Fehlende Transparenz: KI-halluzinierte Inhalte sind nicht nachvollziehbar.
- Wissenslücken bei Nachwuchs: Automatisierung ersetzt Lernprozesse.
- Institutionelle Barrieren: Zeitschriften wie Nature verbieten KI-Autorschaft.
Zous Konferenz ist ein notwendiger Schritt, aber sie bleibt ein kontrolliertes Experiment ohne externe Validierung. Ob sie die Lücke zwischen Hype und Evidenz schließen kann, ist offen.
Takeaways:
- KI kann Forschungsprozesse beschleunigen, aber ihre Entscheidungen bleiben oft intransparent.
- Die Automatisierung wissenschaftlicher Arbeit könnte Lernprozesse bei Nachwuchsforschern untergraben.
- Zeitschriften wie Nature blockieren KI-Autorschaft, was den versteckten Einsatz fördert.
- Agents4Science ist ein Experiment, das systematische Daten liefern soll, aber ohne externe Validierung.
Die Rolle des Menschen: Berater, Gutachter oder Zuschauer?
Bei Agents4Science muss die KI Erstautorin aller Beiträge sein, während Menschen als Berater fungieren. Ein menschliches Expertenteam, inklusive eines Nobelpreisträgers, bewertet die besten KI-Beiträge. Zou hofft auf „interessante Entdeckungen“ oder „interessante Fehler“ der KI.
Kritiker wie Molly Crockett fordern die Einbindung von Erkenntnistheoretikern und Wissenschaftsphilosophen, um KI-Forschung systematisch zu gestalten. Crockett plädiert für durchdachte Experimente, bevor KI die Durchführung wissenschaftlicher Arbeiten übernimmt.
Ich sehe hier ein Dilemma: Wenn der Mensch nur noch Berater oder Gutachter ist, könnte das kritische Verständnis wissenschaftlicher Methoden langfristig leiden. KI-Systeme agieren ohne transparente Überprüfbarkeit, was die epistemische Tiefe menschlicher Forschung untergräbt.
Die Rollenverteilung bei Agents4Science ist klar:
- KI-Agenten: Erstautoren, Durchführung der Forschung.
- Menschliche Gutachter: Bewertung der Top-Beiträge.
- Text-to-Speech-Präsentation: KI „präsentiert“ ohne menschliche Vermittlung.
Zou sagt: „KI-Agenten sind nicht an Zeiten gebunden. Sie könnten rund um die Uhr mit uns zusammenarbeiten.“ Doch ohne menschliche Expertise bleibt unklar, ob KI wirklich Neues entdeckt oder nur bestehende Muster kombiniert.
Automatisierung beschleunigt Forschung, aber ohne menschliche Expertise fehlt die epistemische Tiefe.
Was die Konferenz für die Zukunft der Wissenschaft bedeutet
![]()
Agents4Science ist die erste wissenschaftliche Konferenz, bei der alle Beiträge von KI-Systemen erstellt werden. Zou initiierte sie, um systematische Daten zu sammeln, die bisher fehlen. Ein menschliches Expertenteam bewertet die besten KI-Beiträge parallel zu automatisierten KI-Gutachten.
Die Konferenz könnte ein Wendepunkt für die Anerkennung von KI als wissenschaftliche Akteurin sein oder ihre Grenzen aufzeigen. Erfolgreiche Beiträge würden Druck auf Zeitschriften ausüben, KI-Autorschaften zuzulassen. Scheitern würde zeigen, dass menschliche Expertise in Hypothesenbildung und Fehlerkorrektur unverzichtbar bleibt.
Zous Studie in Nature zeigt das Potenzial: KI-Agenten entwickelten in unter 24 Stunden Nanokörper gegen COVID-19. Doch die Agenten wählten Nanokörper nicht aus biologischer Optimierung, sondern wegen technischer Einschränkungen. Das ist ein technisch getriebener Kompromiss, der zufällig funktionierte.
Mögliche Outcomes der Konferenz:
- Validierung: KI findet reproduzierbare Hypothesen.
- Scheitern: Beiträge enthalten systematische Fehler.
- Prozessinnovation: Hybride Gutachten etablieren sich.
Die Erfolgsmetrik könnte so aussehen:
Erfolgsmetrik = (neue Hypothesen / (Fehlerrate + menschl. Korrekturaufwand))
Zou betont: „KI-Agenten könnten 24/7 mit uns zusammenarbeiten, aber wir wissen nicht, ob sie wirklich Neues entdecken.“ Die Konferenz wird zeigen, ob KI mehr ist als ein Werkzeug.
Zitierhinweis
Dieser Artikel kann wie folgt zitiert werden:
Müller, Tobias (2025). Eine Konferenz ohne Menschen: Was Agents4Science anders macht. ispringen.dev. Abgerufen am 28.08.2025.
Quellen